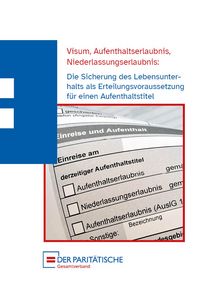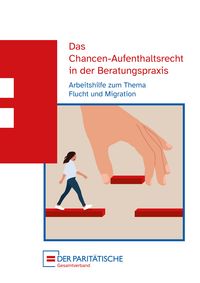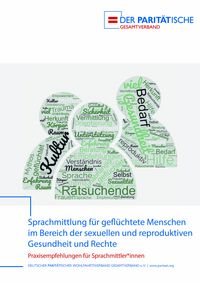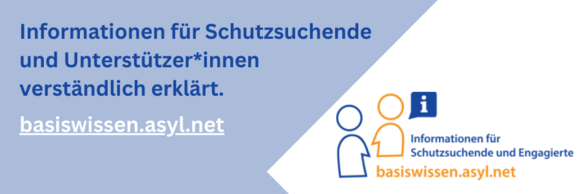Flucht

Grundgesetz, Genfer Flüchtlingskonvention, Europäische Menschenrechtskonvention und geltendes Europarecht verpflichten Deutschland wie auch andere Staaten dazu, Menschen Asyl, Flüchtlingsschutz oder subsidiären Schutz zu gewähren.
Als Verband setzen wir uns auf politischer und fachlicher Ebene dafür ein, dass Geflüchteten dieser Schutz gewährt wird und der Zugang zu einem individuellen Recht auf Asyl gewährleistet wird.
Wir unterstützten unsere Mitgliedsorganisationen, insbesondere die Landesverbände und überregionalen Mitgliedsorganisationen, z.B. durch Umsetzung von Bundesprogrammen, Schulungen und Weiterbildungen, Informationsmaterialien oder Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln.
Mit der Umsetzung von Projekten zur Förderung des ehrenamtlichen Engagement in der Flüchtlingshilfe über Projekte zur Empowermentarbeit mit geflüchteten Frauen bis hin zur Unterstützung von Migrant*innenselbstorganisationen setzen wir und unsere Mitgliedsorganisationen uns dafür ein, dass Schutzsuchenden das Ankommen und Bleiben in Deutschland gelingt.
Mit Hilfe unserer Publikationen, Stellungnahmen und Fachinformationen leisten wir einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit den Themen Flucht und Asyl.
Wir sind mit anderen Organisationen Träger des "Informationsverbund Asyl und Migration“ und Mitglied beim Europäischen Flüchtlingsrat (ECRE).
Bei Aktion Deutschland Hilft e.V., einem Zusammenschluss deutscher Hilfsorganisationen, die bei großen Katastrophen und Notsituationen im Ausland Hilfe leisten, sind wir mit 11 Mitgliedsorganisationen vertreten.
Aktuelles
Europäisches Parlament billigt Reform des Europäischen Asylsystems
Nach jahrelangen zähen Verhandlungen hat das EU-Parlament am 10. April der umstrittenen Reform des Europäischen Asylsystems zugestimmt. Entgegen… weiterlesen
Bundesgesetzliche Regelung zur Einführung von Bezahlkarten verabschiedet
Im Bundestag wurden am 12.04.2024 Änderungen am Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beschlossen, die den Einsatz von Bezahlkarten bundesgesetzlich… weiterlesen
Bezahlkarte für Geflüchtete: Paritätischer kritisiert das heute verabschiedete Gesetz und appelliert an Länder und Kommunen
Zwar gebe es einige Verbesserungen auf Initiative der Grünen, die Bezahlkarten seien dennoch schikanöse Symbolpolitik. weiterlesen
Migrationsabkommen zwischen Albanien und Italien vereinbart
Während in Deutschland aktuell die Debatten rund um die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten zunehmend an Fahrt gewinnen – jüngst hat die… weiterlesen
Arbeitshilfen
Visum, Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis: Die Sicherung des Lebensunterhalts als Erteilungsvoraussetzung für einen Aufenthaltstitel
Die Sicherung des Lebensunterhalts ist eine entscheidende Voraussetzung für die Erteilung und Verlängerung der meisten Aufenthaltstitel in… weiterlesen
Das Chancen-Aufenthaltsrecht in der Beratungspraxis
Bereits im November 2021 wurde mit dem Koalitionsvertrag der Ampelkoalition die Einführung eines Chancen-Aufenthaltsrechts angekündigt. Dieses sollte… weiterlesen
Sprachmittlung für geflüchtete Menschen im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte: Praxisempfehlungen für Sprachmittler*innen
Sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte beschreiben das Menschenrecht, frei und selbstbestimmt über den eigenen Körper, die Sexualität,… weiterlesen
Weiterführende Links
Hier finden Sie weitere Informationsangebote rund um das Thema Flüchtlingshilfe, u.a. zu Rechtsprechung, Herkunftsländern sowie zu Verwaltungsvorschriften und Gesetzestexten.
- Ein Projekt des Informationsverbundes Asyl und Migration
- Hier finden Sie Arbeitshilfen und Materialien, Referent*innen, Projekte, Links, Literatur, Schulungsvideos,Termine und vieles mehr rund um das Thema ehrenamtliches Engagement für Flüchtlinge.
- Ein Projekt des VIA-Bundesverbandes
Die Deutschland-Karte zeigt die Angebote zur Flüchtlingshilfe und -Integration (ehrenamtliche und professionelle Angebote)
Das Info-Portal der Refugees Welcome Map bietet kommentierte Web-Adressen zu vielen Themen rund um Flucht, Flüchtlingshilfe und Integration
BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
- Allgemeine Informationen zum Asylverfahren
- Kontaktdaten der Außenstellen des Bundesamtes
- Regelmäßige Publikationen zu den Themen Asyl, Migration und Integration, z.B. Entscheiderbrief
Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration der Bundesregierung
- Allgemeine Informationen zum internationalen Flüchtlingsschutz, Herkunftsländerinformationen, Stellungnahmen
- Allgemeine Informationen
European Council on Refugees and Exciles (ECRE): Der europäische Flüchtlingsrat
- Informationen zur EU-Asylpolitik sowie hilfreiche Adressen und Links zu Flüchtlingsberatungsstellen in Europa
Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge
- Informationen und Arbeitshilfen zur Situation von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF)
Rechtsprechung und Herkunftsländerinformationen:
- Informationsverbund Asyl & Migration:
Rechtsprechungsdatenbank und Artikelsammlung zum Aufenthalts- und Sozialrecht für Flüchtlinge und Migrant/-innen
www.asyl.net - European Country of Origin Information Network:
Umfassende Datenbank zu Informationen und Berichten zu den einzelnen Herkunftsländern
www.ecoi.net - Schweizerische Flüchtlingshilfe:
Informationen, Berichte zu einzelnen Herkunftsländern
www.fluechtlingshilfe.ch - Arbeitshilfen zum Flüchtlingsrecht Flüchtlingsrat Berlin:
Arbeitshilfen und Rechtsprechungsübersichten zum Aufenthalts- und Flüchtlingssozialrecht (ständig aktualisiert)
www.fluechtlingsrat-berlin.de - GGUA Flüchtlingshilfe e.V. - Projekt Q - Qualifizierung der Flüchtlingsberatung
Beratung in allgemeinen und Einzelfragen für Beratungsstellen
www.einwanderer.net
Verwaltungsvorschriften/Gesetzestexte
- Bundesministerium der Justiz: Gesetze im Internet
Alle Bundesgesetze und Verwaltungsvorschriften in aktueller Fassung online
www.gesetze-im-internet.de